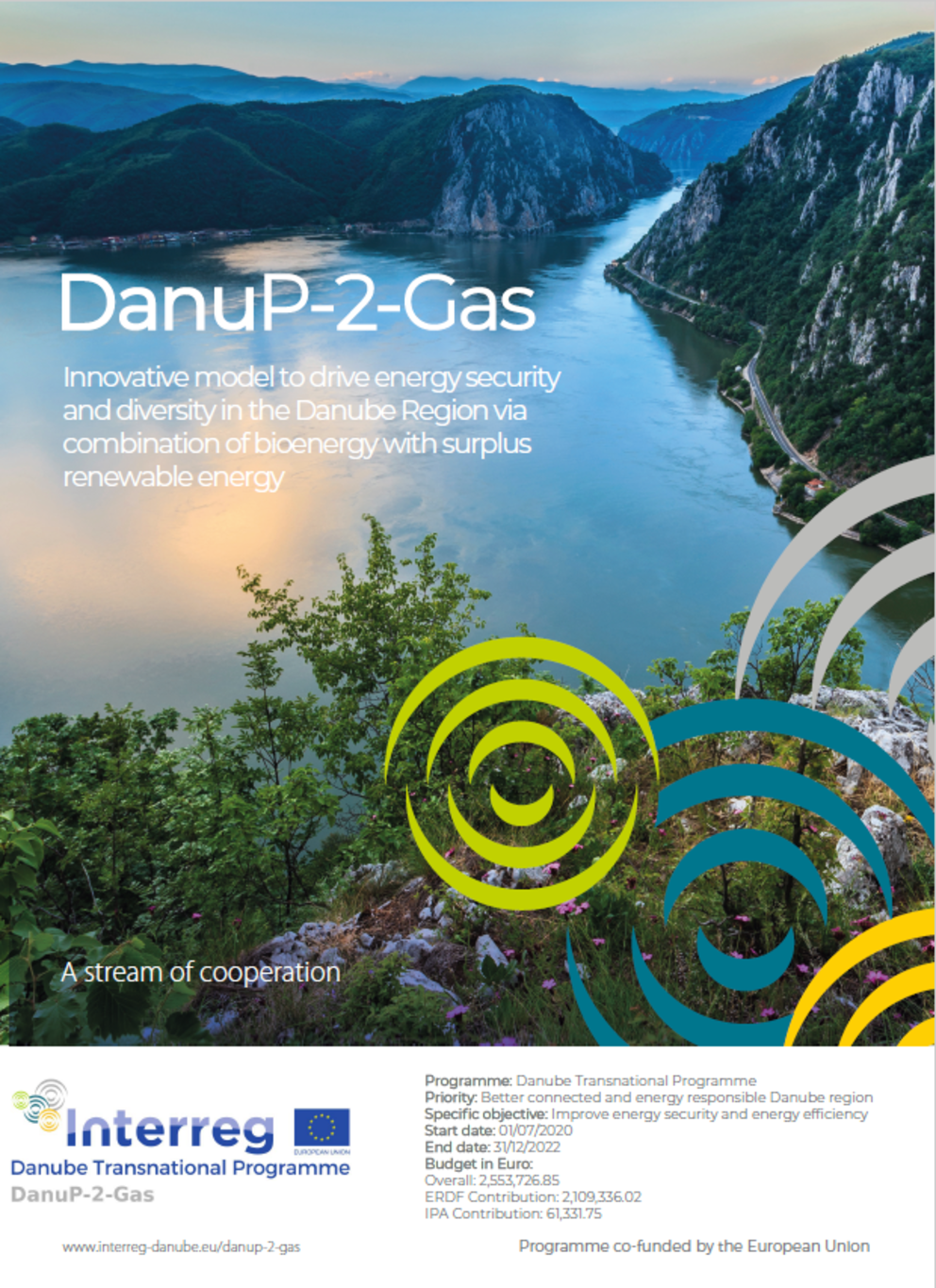Das EU-weite Forschungsprojekt DanuP-2-Gas an der Hochschule Landshut zielt darauf, die Abkehr von fossilen Brennstoffen in zehn Ländern des Donauraums zu beschleunigen. Daran beteiligt sind 14 Partner aus ganz Europa, darunter auch die TH Deggendorf.
Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer: Die Donau zählt zu den ältesten europäischen Handelsrouten und verbindet zehn Länder miteinander. Diese Rolle kommt ihr auch im neuen Forschungsprojekt DanuP-2-Gas zu, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Energiewende im gesamten Donauraum voranzubringen. Unter der Leitung des Technologiezentrums Energie (TZE) an der Hochschule Landshut entwickeln Forscherinnen und Forscher aus 14 Partnerunternehmen und -institutionen ein umfassendes Konzept, das alle zehn Länder entlang der Donau umfasst und zu einer einheitlichen Erzeugungs- und Speicherstrategie für erneuerbare Energien in der Region führen soll. Das ambitionierte Projekt wird vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie von Instrument for Pre-Accession Assistence (IPA) gefördert. Die gesamte Projektsumme liegt bei über 2,5 Millionen Euro.
Der Anteil und die Effizienz der regenerativen Energien ist bisher gering. Das macht die Region abhängig von Energieimporten.“ Prof. Dr. Raimund Brotsack
Erneuerbares Erdgas als Alternative
Die Idee der Forschenden ist es, die Kopplung des Strom- und Gassektors voranzutreiben, derzeit ungenutzte Energiequellen einzubeziehen und erneuerbares Erdgas (Renewable Natural Gas – RNG) zu erzeugen. Damit wollen sie eine effektive Alternative zu fossilen Energieträgern entwickeln, insbesondere zu fossilem Erdgas. „Obwohl der Donauraum ein enormes Potenzial für die nachhaltige Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien birgt, sind der Anteil und die Effizienz dieser regenerativen Energien hier bisher gering“, erklärt Projektleiter Prof. Dr. Raimund Brotsack vom TZE, „das macht die Region abhängig von Energieimporten“.
Einmaliges Konzept
Hier setzt das neue Forschungsprojekt an: Das Projektteam möchte die Energie aus Biomasse und erneuerbaren Energiequellen – wie beispielsweise Sonnen- und Windenergie – langfristig in Form von erneuerbarem Erdgas speichern. „Das ist bisher einmalig“, so Brotsack.
Das Konzept ist bisher einmalig.“ Prof. Dr. Raimund Brotsack
Konkret heißt das: Ungenutzte organische Reststoffe wie Holz werden zu Biomasse verarbeitet, über den Transportweg Donau an zentrale Knotenpunkte gebracht und dort unter Einbeziehung von erneuerbarer Energie aus Wind und Sonnenlicht zu RNG in Erdgasqualität umgewandelt. Das so erzeugte RNG kann über das vorhandene Erdgasnetz europaweit verteilt und genutzt werden. Damit verringert sich der Einsatz kohlenstoffhaltiger Energieträger. Die positiven Folgen: Es gelangt weniger Treibhausgas CO2 in die Atmosphäre. Zudem ist die Region weniger abhängig von fossilen Erdgasimporten.
Das Projekt "DanuP-2-Gas" in Zahlen
Das Projekt „DanuP-2-Gas – Innovatives Modell zur Förderung der Energiesicherheit und -vielfalt im Donauraum durch Kombination von Bioenergie mit überschüssiger erneuerbarer Energie“ läuft noch bis Ende 2022. Die Projektleitung übernimmt das Technologiezentrum Energie (TZE) der Hochschule Landshut. Daneben sind 13 weitere Projektpartner sowie 10 assoziierte Partner aus insgesamt 12 europäischen Ländern am Forschungsprojekt beteiligt, darunter auch die TH Deggendorf. Gefördert wird das Projekt vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) mit über 2,1 Millionen Euro sowie von Instrument for Pre-Accession Assistence (IPA) mit über 61.300 Euro. Die gesamte Projektsumme liegt bei über 2,5 Millionen Euro.
Technologie direkt nutzbar
Die in RNG gespeicherte Energie kann dann in den verschiedenen Sektoren Wärme, Strom und Transport genutzt werden, ohne dass bereits vorhandene Anlagen technisch umgerüstet werden müssen. Dr. Tim Bieringer, Mitarbeiter am TZE, erläutert: „Ein bestehendes Gas- oder Dampfkraftwerk, das Wärme und Strom aus Erdgas produziert, kann genauso mit RNG betrieben werden wie mit fossilem Erdgas.“
Ein bestehendes Gas- oder Dampfkraftwerk kann genauso mit RNG betrieben werden wie mit fossilem Erdgas.“ Dr. Tim Bieringer
Zu diesem Zweck bewerten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Biomasse-Potenzial und die vorhandene Infrastruktur in der Donauregion und veröffentlichen die aufbereiteten Daten in einem „Renewable Energy Atlas“, der allen interessierten Stakeholdern zugänglich ist. „Indem diese Technologie unmittelbar genutzt werden kann, ist das Projekt sowohl für Investoren als auch für Verbraucherinnen und Verbraucher interessant“, ergänzt der Projektleiter, „denn sie sichert uns eine stabile Energieversorgung mit klimafreundlichem Erdgas.“
Plattform für Interessengruppen
Als zentrale Grundlage für das Forschungsprojekt dient die Donau-Energieplattform, die während des Projekts ENERGY BARGE entwickelt wurde. Dieses Kooperationsnetzwerk bringt Energieagenturen, Wirtschaftsakteure, Behörden und Forschungseinrichtungen zusammen, bezieht sie in die Prozesse mit ein und ermöglicht ihnen, sich auszutauschen sowie ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Ebenfalls Aufgabe des Forschungsprojekts ist es, die politische und rechtliche Lage der zehn Länder zu untersuchen. Dazu kooperieren die Projektpartnerinnen und -partner mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, um eine langfristige Strategie für den gesamten Donauraum zu erarbeiten, von der alle Länder profitieren.
Indem diese Technologie unmittelbar genutzt werden kann, ist das Projekt sowohl für Investoren als auch für Verbraucherinnen und Verbraucher interessant.“ Prof. Dr. Raimund Brotsack
Nützliche Instrumente zur Umsetzung
Um die wirtschaftliche Machbarkeit der Konzepte zu unterstreichen, entwickeln die Forscherinnen und Forscher schließlich zwei Tools. Sie ermöglichen den Ländern, potenzielle Standorte für sogenannte „Sector Coupling Hubs“ zu identifizieren. Dabei zeigt ein Optimierungstool die spezifischen Voraussetzungen eines jeden Standorts auf und empfiehlt dafür geeignete Anlagen und Betriebsweisen. „Damit sparen sich zukünftige Investoren die anfängliche Analyse“, erklärt Brotsack, „und die Stakeholder können am Ende selbst Folgeprojekte zur tatsächlichen Erbauung von Anlagen entwickeln.“
Autor: HAW Landshut